Straschek 1963-74 Westberlin
Teil 2
Elf ereignisreiche Jahre in Westberlin hinterließen deutliche Spuren im Leben von Günter Peter Straschek. Er verarbeitet sie in dem Text “Straschek 1963 -74 Westberlin”. Der Titel in der dritten Person verweist auf den selbstreflexiven Charakter des Essays. In seinen Berliner Jahren betätigte sich Straschek als Filmemacher, -historiker, und -theoretiker, als Publizist und politisch Aktiver in der 68er Revolte. Außerdem war er Teil des ersten Jahrgangs von Studierenden an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB). Zu seinen Kommiliton*innen gehörten Personen wie Helke Sander, Harun Farocki, Hartmut Bitomsky, Johannes Beringer oder Holger Meins. Erstmals liegt nun mit dieser Übersetzung sein Text auch auf Niederländisch vor. Sein Essay ermöglicht einen ganz besonderen Zugang zu den filmästhetisch-theoretischen Debatten und praktisch-politischen Auseinandersetzungen einer Generation von Filmemacher*innen, die das Filmschaffen in Deutschland grundlegend erneuern sollten, und die in ihren politischen und formalen Experimenten ihre Vorkämpfer*innen aus den Tagen des Oberhausener Manifests mehr als bieder aussehen ließen. Die während dieser Periode von dem am 23. Juli 1942 in Graz geborenen Straschek gemachten Erfahrungen und verfolgten Interessen fließen in seinem Text für die Filmkritik in verdichteter Form zu einer virtuosen Komposition zusammen. Straschek schuf eine Konstellation aus unterschiedlichsten Textsorten, wie etwa polittheoretischen und filmästhetischen Überlegungen, Anekdoten, tagebuchähnlichen Einträgen, Briefen oder auch eine Fütterungsanweisung für die Katze von Danièle Huillet. Es handelt sich um eine Textmontage, die wohl heute beinahe jede Redaktion einer Filmzeitschrift stark kürzen und formal verändern würde. Der Text verdankt seine Veröffentlichung in dieser Form dem Geist der damaligen Zeit, besonders aber den redaktionellen Leitlinien der Filmkritik, in der er veröffentlicht wurde, und die damals sicherlich die profilierteste Zeitschrift für Film im deutschsprachigen Raum darstellte.
– Julian Volz1

25.
Faschistsein aus Blödheit, Schreibtischtäterschaft gepaart mit der Schauspielern eigenen Opportunität, alles für “eine gute Rolle” zu tun: dazu war Veit Harlan ein mieser Regisseur und ist Kristina Söderbaum eine dumme Pute. Dennoch möchte ich mir erlauben, beide in Schutz zu nehmen, insofern sie als Stellvertreter und Blitzableiter für zufiele Nazischweinereien herhalten mussten. Dutzende von schmierigen Mitäufern haben sich an Harlan “reingewaschen”. Nur ein Beispiel: laut Harlans Aussage an den Regisseur Franz M. soll sich der Schauspieler Albrecht Schoenhals zweimal um die Rolle des Jud Süss beworben haben: er war Harlan dafür nur “zu schlecht”; Schoenhals macht heute auf “antifaschistisch”, hat Harlan in Prozessen belastet. Es gab in der Film- und Theaterbranche nicht so viele Nazi (Maria Paudler oder Hilde Krahl, Carl Auen oder Eugen Rex) wie anzunehmen man geneigt ist, freilich noch weniger Antifaschisten. Eine unpolitische und parvenuehafte Gesellschaftsschicht, interessiert nur an materieller Sicherstellung und gesellschaftlicher Anerkennung, sind die meisten davon bereit, für jedermann zu spielen, sofern ihnen private Freiheiten belassen werden. Für die Film- und Theaterfritzen war dies in der Nazizeit teilweise gegeben. Man soll heute nicht so tun, als hätten diese armen Künstler unter dem Terrorregime sehr leiden müssen. Im Gegenteil: es war ihre subjektiv schönste Zeit gerade aufgrund ihres wirtschaftlichen + künstlerischen (nach Verjagung der jüdischen Konkurrenz) Wohlergehens als Mittelschicht besonderer Prägung. Ob “schwerer Nazi” oder “unpolitisch” oder “immer schon gegen Adolf”: in unserer Branche ist das ein- und dieselbe Bagage gewesen. Nur deshalb würde ich für Harlan & Söderbaum eintreten.
[Es freut mich zu hören, dass aus ähnlichen Erwägungen Kortner bereit gewesen sein soll, Harlan in einem münchener Nobelhotel öffentlich die Hand zu reichen. Er sah davon ab, “weil ich dann den Rest meines Lebens briefeschreiben müsste, an meine Freunde und Feinde”.]
26.
Am 23. Juli 1942 in Graz geboren, verließ ich 19jährig Österreich. 1963 siedelte ich nach Westberlin. Die Jahre dazwischen war ich unterwegs. Diese Tramps durch Griechenland, Türkei, Israel und die meisten westeuropäischen Staaten waren ein Ausbrechen, stets empfand ich sie als Befreiung. Plötzlich lernte ich so viele andere Bedingungen, Situationen, Menschen, Verhaltensweisen, Sprachen und sonstiges kennen, musste mich in allen möglichen Jobs durchschlagen; ich wurde gezwungen, radikal umzudenken und zu neuordnen, nichts aus der Schule war brauchbar, alles kam anders; in Graz frauenlos, obschon ich einige Mädchen scheu begehrte, holte ich auch das ausgiebig nach. Es war wie im Rausch, kinderkrankhaft, erst in Westberlin wurde mir manches daraus verständlicher. Seitdem habe ich zu Ortsveränderungen ein goethesches Verhältnis.
27.
Würde das TV ein halbes dutzend Filme von John Brahm oder Edward Ludwig oder Jacques Tourneur oder Frank Borzage oder Edgar George Ulmer ausstrahlen, Spass an einem Bluff vorausgesetzt, liesse sich dasselbe Affentheater inszenieren wie unlängst für Douglas Sirk. Aus erstklassigen Handwerkern müssen kinematografische Genies stilisiert werden, die Cahiers du Cinéma vor 10 Jahren werden noch einmal durchgeblättert; dann ist die Stunde des Enno P. nebst Gattin gekommen – auf fremde Züge aufzuspringen und sich hierorts als Lokomotivführer ausgeben. Hätte ich Zeit und Lust, zusammen mit der Beta und dem TV ließe sich aus Ulmer der größte Regisseur nach Griffith machen [Und sollte sich meine Finanzlage wieder verschlechtert, will ich dem Hanser Verlag eine Monografie über den amerikanischen Indianerregisseur Horace “White Feather” McFarland (1883-1944) anbieten.]
28.
Selbstredend bin ich ein waschechter Österreicher (geblieben), was sich schon in der Verachtung für meine Landsleute & Heimat beweist. Tatsächlich ist mir aus der neueren Geschichte kein Staat bekannt, sich zum einen (1936) so schäbig benommen hat und zum anderen (1945) so billig und ungestraft davongekommen ist, bis heute jegliche Einsicht verweigert hat, stattdessen die Frechheit besitzt, sich als überfallenes Opfer aufzuspielen. Was die Osterreicher am Nazismus letztlich gestört hat: dass er von Piefkes so unschlampig geführt worden war. Nirgendwo auf der Welt gibt es noch so viel Nazigesindel wie in Österreich. Begabt, aber charakterlos. Eine imposante Verfallskultur bis in die 20er Jahre, ein paar hervorragend verrückte Schriftsteller, exzellente Musiker und eine Handvoll gute Schauspieler. Das beste an Österreich scheint mir noch immer sein Reisepass zu sein. Wie beschissen dieses Land ist, geht allein aus der Tatsache hervor, dass es Stalin nicht einmal geschenkt haben wollte.
29.
Wenn im TV als Nachspann etwas über die Arbeitsorganisation und Produktionsweise der Sendungen veröffentlicht würde werden, übersichtlich Herstellungskosten, wenn dem Zuschauer ein paar banale Einblicke ermöglicht würden werden (was kostet die Requisite eines Anzugs für Dietmar Schönherr, den er sich in “Wünsch Dir was” großzügig von Kindern beschmieren lässt, um so Eltern Nepp für “progressive” Erziehung zu demonstrieren), wenn die Honorare von Robert Lembke, Erik Ode, Anneliese Rothenberger oder Tatortfritzen + Konsorten mit dem monatlichen Einkommen einer Cutterin verglichen werden könnten, wenn die Dramaturgie ihre Wahl parteiisch und nicht “demokratisch” erklären müsste, wenn Statfragen und Personal-politik durchsichtig gemacht würden werden: wenn das TV Bereitschaft zeigte sich selbst etwas zu demystifizieren, so schiene mir das viel politischer als mancher wehleidige Streifen, der so “bewusstseinsverandernd” auftritt, dass einem schon die Frage nach den Kohlen in der Kehle steckenbleiben soll.

30.
Aus naheliegenden Gründen habe ich zu Prostituierten keinen Kontakt. Weder habe ich es notwendig, noch hatte ich den Zaster parat, vor allem würden mir die Verkehrsregeln keinen Spaß machen. Als Junge trieb ich mich freilich nach dem Wiener Theaterbesuch (Kelleravantgarde. Ich trampte 200 km von Graz nach Wien, übernachtete im Park, retour tags darauf, und wurde ein Meister im Fälschen elterlicher Unterschriften für die Schule) in der Kärntnerstrasse nebst Seitengassen herum. Gut fünfzehn Jahre später ging ich aus sentimentalischen Gründen zu einer halbwegs lieben und mollerten Hur. Nach ein paar Höflichkeitsfloskeln, ich sei gut gewesen, erklärte sie mir, diesen Job nur deswegen auszuüben, weil sie o. Professor Soundso für eine Operation honorieren müsse. Denn ihre Tochter sei durch einen Schock taubstumm geworden, als nämlich sie, die Mutter, vom abgeheirateten Strizzi geschlagen wurde, die Kleine das mitansehen musste. Ich war von dieser Frau beeindruckt. Während in “unseren Kreisen” der Innovationszwang dergestalt ist, dass man ständig mit neuen Blödeleien intellektuell aufwarten muss, jede Erkenntnis ihren modernistischen Touch für Verkaufszwecke erhält, war diese berufstätige Frau nicht gezwungen, sich fortschrittlichere Schmähs auszudenken, denn in Österreich sind die alten gut genug Man stelle sich dieselbe mollerte Hur im westdeutschen TV vor, keuchend und etwas verschwitzt, mit viel Denkgepause dazwischen die Widersprüch in unsra G’sellschaft. Jetzt muss i jeden Abend am Strich geh’n ...
31.
Im Herbst ’63 war ich entschlossen, in die DDR zu übersiedeln. In einer Fabrik wollte ich arbeiten, mehr noch: ich meinte mein Dasein grundsätzlich verändern zu müssen. Doch in Berlin (DDR) schickte man mich tagelang von einem Ministerium zum anderen, lehnte höflich ab. Einen herumkritisierenden berufslosen Österreicher konnte dieser erste deutsche Arbeiter- und Bauernstaat nicht gebrauchen. Dafür will ich ihm ewig dankbar sein.
32.
Bald nach jener denkwürdigen Uraufführung am 4. Juli ’65 an der Berlinale lernten wir uns kennen. Heute verbindet uns eine enge Freundschaft. Ich weiss in der gesamten Branche von niemandem, der so leidenschaftlich, ausdauernd und gewissenhaft das Filmemachen betreibt wie die beiden. Sie gehören zu den wenigen, die wirklich in diesem Metier arbeiten [(und nicht herumspielen). Sie realisieren politische Filme, nicht Filme über Politik] und auf die ich mich verlassen kann. Wiederholt sei für diejenigen, die es noch nicht wissen: ihre Filme sind das Aufregendste und Fortschrittlichste an Kino heutzutage.
Ich fühle mich beiden vermutlich so nahe, weil ich mich in einem ähnlichen Dilemma wähne: in dem Einsehenmüssen vermittels einer falschen Verhaltenspolitik bel personalisierter Anstrengung, Integrität, materiellem Schlechtgehen seinen Zielen näher zukommen/ anstatt in einer politischen Fraktion Quasiopfer jener Imponderabilien werden zu müssen, die verschiedene Arbeitsformen gar nicht mehr zulassen. St-H. stellen eine kaum vorstellbare Potenzierung individueller Anstrengung dessen vor, was ein (oder zwei) Personen in einer Branche der Zuhälter und Huren leisten können. Ein Kampf freilich, Spuren von Askese, gefilterten Anarchismus und Moralismus offenlegend, immense Nervenbelastung mit Durchhaltevermögen, ein zum Quell neuer Leistungen angezapfter Masochismus – grösste materielle Sorgen. (Zu all dem wäre ich nie fähig, allerdings fehlte mir auch eine Daniele H.] Jedoch ist am Vorwurf, wie er beiden gemacht wird (und stellenweise auch mir), sie seien “aristokratisch” etwas dran. Sich für den Einzelkampf entschieden habend, wird man dann nicht anders können. Nur darf man nach St.-H. denselben Weg nicht mehr gehen. Menschliche Unikate. Eine Wiederholung würde die Industrie nicht zulassen. Schliesslich sehen wir in St.-H. nur das eine erfolgreiche Beispiel des so notwendigen Widerstandes. Kein Wort über die Opfer in dieser Branche (nicht alles Zuhälter und Huren). Bei unserer Freundschaft darf ich sagen: die St.-H. als Vorbild, nicht als Lösung.
[Dafür gelangten Werner D., Hartmut B und Harun F. zur Erkenntnis (der ich mich anschliessen möchte), gute Filme gäbe es nur noch von den Alten wie Ford oder Hawks. Im Falle St.-H. wurde die Lösung gefunden, Jean-Marie und Daniele zu addieren.]
33.
Eine Redaktionssekretärin beim WDR will in meinem Pornofilm mitvögeln, nicht aber mit mir ins Bett gehen. So etwas nenne ich Moral.
34.
Die Filmseminare am Institut für Sprache im technischen Zeitalter der TU bei (später Prof.) Dr. Friedrich K. waren für mich entscheidend. Brachte das Auszählen von Einstellungen nach Bewegung, Grösse oder Handlungsachse auch nicht viel ein, Moviesense wurde doch differenziert, entidealisiert. Ein 20minütiges Referat über eine 2minütige Einstellung verlangte präzises Hinschauen und Oberlegen. Es war in diesen Seminaren, wo ich erstmals einzelne Rollen zigmal durchgegangen bin, jeweils nur auf ein Element (Kameraführung, Licht, Ton, Schnitt, Schauspieler, Dekor etc.) achtend, wo ich einigermassen begriffen habe, was Film nicht-antiintellektuell sein könnte (musste mir die damalige Schulung auch über Gebühr positivistisch erscheinen). Für die Jahre an der TU (von ’84 bis ’66) war Dr. Friedrich K. – ungeachtet seiner dann enttäuschenden Veröffentlichungen, seines unsolidarischen und felgen Verhaltens – mir zum Lehrer in Sachen Film geworden.
35.
Was aus mir geworden wäre, hätte ich die in mich gesetzten Erwartungen als Talent (zu Graz) erfüllt.
Roman im Residenz Verlag Salzburg, Prosa in den manuskripten; aus dem “Talentschuppen und Geheimtip” Graz könnte ich bis in die “literarische Bundesrepublik” buchen. Mit ein paar Künstlern würde ich mich tageintagaus in ein, zwei Kneipen treffen und mich vollaufenlassen, zur allgemeinen Gaudi ein paar Stück Kleinbürger reizend. Saufen, Schmähmachen und Nichtpolitik sind des modernen steiermärkischen Dichters Ingredienzien. Hätte ich dann meine “Schaffenskrise”, müsste ich einer Kellnerin den Arsch zeigen – das empört die “Scheissbürger” und brächte mich wieder ins Gerede. Mit 35 wäre ich eine unantastbare Stadtparkerscheinung, mit 65 würde mir der Professorentitel verliehen werden. Dazwischen hätte sich der Ruhm zwar wieder aufs Lokale reduziert; hat der Mythos einmal eingesetzt, ist zu Lebzeiten nichts mehr dagegen zu machen.
17jährig, selbst begeisterter Bohemien und Herumstenkerer (eine unserer Vorlieben bestand darin, um 4h früh besoffen im Sportbuffet Gulaschsuppeessen und dort nach “Nazischweinen” zu suchen. Die Eltern mussten für meine neuen Brillengestelle aufkommen), erlebte ich diese alten Herren, für jeden Fusel erzählbereit, was für Provinztalente sie vor 20, 30 oder 40 Jahren gewesen seien: und es eben waren! In dem rückständigen Land Österreich, schollenbehaftet und negativ konkurrenzlos, unpolitisch und antianalytisch eingestellt, nähert man sich, stets mit dem Sumpf beschäftigt, aus dem man heraus will, unbemerkt jenem Bürgertum an, das man über private Frechheiten, künstlerische Avantgarde und gestattete Privilegien zu attackieren meint. Weit und breit keine Idee, Bewegung oder Partei (sicherlich nicht die KPÖ), die einem helfen könnte. Was bleibt, ist Inzucht mit der Hoffnung des als ob nicht.
Der Literatursteirer passable Erfolge in der BRD lassen sich verstehen. Nicht zufällig sind die Grazer zu einem Zeitpunkt importiert worden (im Rattenschwanz von Peter H.s Erfolgen), wo sie als Gegentrend zur bundesrepublikanischen Kunstpolitisierung herhalten konnten. Die öftere Peinlichkeit “linker” Schriftstellerei in der BRD liess das Vorhaben nicht chancenlos erscheinen. Tatsächlich ist österreichische Dichtkunst wesentlich differenzierter und amüsanter als das, was die Grass, Walser, Hochhuth & Konsorten zu bieten haben. Letztlich konnte der starken Bewusstwerdung und Politisierung im BRD Kulturbereich kein politisch artikulierter Widerstand entgegengebracht werden; nach den Erfahrungen des Nazismus war dies selbst für ein nichtliberales Bürgertum etwas ausgeschlossen. Jetzo war Grazens Stunde gekommen. Graz als Exotisches, irgendwo Richtung Balkan gelegen, bekannt durch seine Billigstdoktorate sowie Autofahrern auf der Route ’gen Griechenland. Und in Graz sind die Künstler noch so, wie sie immer waren und es auch sein sollten, da kann man noch für Benn schwärmen, ohne als Faschist beschimpft zu werden: auf der Universität ist es noch immer ruhig, nichts ist da an Veränderung zu befürchten. Nur das Kulturkapital fordert die Moderne, Avantgarde kommt heutzutage aus der Provinz (als Plagiat freilich oder Neuauflage. Da der Nazismus jedoch alles zerstört hat, fällt das nicht so auf). Graz konnte für das künstlich wachgerufene Nostalgiegetue ziemlich unverbrauchte Bohème, Dekadenz und Künstlerattitude liefern. Und nicht traditionslos. Seit bald einem Jahrhundert blickt man in Österreich auf seinen Verfall. Nicht, dass man dagegen etwas unternähme, man glotzt nur verzückt und stolz auf die Kunstprodukte, die von dieser Ausweglosigkeit handeln. Alle paar Jahrzehnte gibt es die notwendige Restaurierung (Substanzverlust). Avantgarde genannt. Doch davon merken die Piefkes soundso nichts.
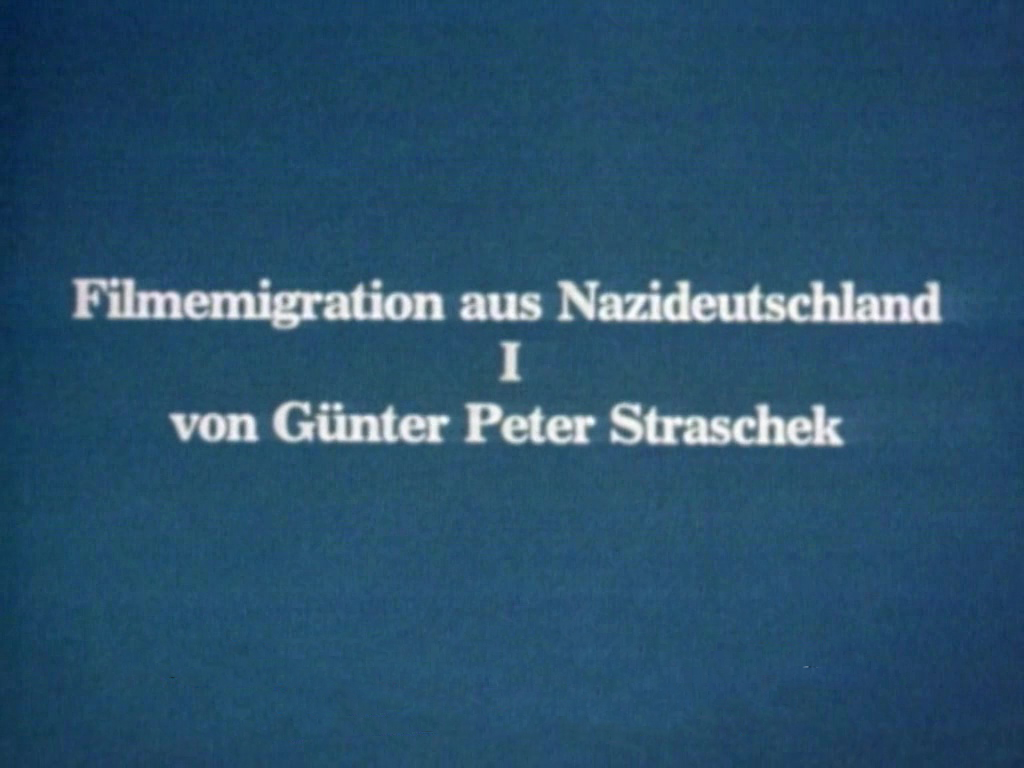
36.
Je später der Abend, Talk Show vom 1. 5. 1974. Ich kenne doofe Frauen, miese Schwule, schmutzige Farbige, geizige Juden und bin freilich kein Misogyn, Rassist, Antisemit etc. Die Schweinereien und Verbrechen gegenüber Minderheiten und anderen (sozial) geschwächten Gruppierungen sind äusserst vielfältig, in einem vergleichsweise liberalen Land wie der BRD auch vergleichsweise fortschrittlich. Oder getarnt. Welch eine zynische Menschenverachtung verbirgt sich in dem Gerede, Frauen, Schwule, Farbige, Juden. Zigeuner, Gastarbeiter oder Verbrecher seien “auch Menschen”, wie du und ich und so fort. Als da Inge Meysel von sich gab, die besten ihrer Freunde seien Homosexuelle (wie erinnerlich waren das in den 50er und 60er Jahren die Juden, vielleicht werden Gastarbeiter oder Zigeuner auch mal schick – ich persönlich wette auf Farbige), balzte ihr Moderator-Freund entrüstet los und entblödete sich nicht seine Frau als Kronzeugin aufzurufen, das heisst, Vivi Bach soll Inge Meysel überzeugen, wie formidabel antihomosexuell Dietmar Schönherr im Bett sein kann. In einer miesen Bahnhofstoilette einem unsympathischen Strichjungen freundlich ja oder nein zu sagen ist mir noch immer mehr Fortschritt Anstand und Mut als dieses schlicht zu nichts verpflichtende Eintreten für Minderheiten im TV oder in der Kneipe, gar nicht zu reden vom Zynismus, sich ein paar Kulturschwule (ach wie sensibel und wie gescheit, belästigen auch keine Frauen usw.) als gesellschaftliche Zierde zu halten.
Bei allen Emanzipationsbestrebungen muss demgegenüber gerade die Unterschiedlichkeit als Recht und Würde in der besonderen Befähigung betont und erhalten werden. Der Homosexuelle ist nicht “wie” der Heterosexuelle; im Kampf um seine soziale Behauptung darf er niemals seine Interessen aufgeben, sich einer pseudosozialen Gleichmachertheorie unterwerfend “retten” – sich damit aufgeben. Dies gilt insbesondere für die Frau und den Verbrecher.
37.
34 Studenten, mehrheitlich nach einem (abgebrochenen) Erststudium oder diversen Berufserfahrungen dezidiert auf die Realisationsmöglichkeit angestauter Ideen wartend, theoretisch meist vorgebildet, selbstbewusst; eine fachlich unzulängliche Dozentenschaft, feige zwischen Direktion und Studentenschaft sich herumstossen lassend; eine überforderte Direktion insonderheit gegenüber Anfangsschwierigkeiten der Akademiegründung und: die unschuldigen Jahre der Studentenrevolte = 1966-68 studierte ich Regie an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin GmbH. (DFFB).
Soweit ich mich erinnere, haben wir ausser Rabbatz nicht sehr viel anderes gemacht, machen können. Allerdings sind viele Stories über wilde Zeiten an der “Berliner Filmakademie” zur Legende und Mythentfachung kolportiert worden (mein Ein Western für den SDS wäre aufschlussreiches Kapitel genug). Für diese Notizen damalige “papers” wiedergelesen – und ich war geschockt ob unseres spätpubertären, teilweise un-politischen Verhaltens. Nicht dass man sich dessen heute genieren müsste. Direktion und Dozentenschaft haben nichts Besseres verdient; schliesslich war es unsere Politik, die späteren Jahrgängen jenen “scheissliberalen Freiheitsspielraum” mit 3-4jähriger Versorgung erweitert und abgesichert hat (ohne dass die Chance genutzt wurde. Die DFFB ist dzt. eine Rentenanstalt für künftige ex-Linke). Selbst bei meiner Übertreibungsmarotte gehe ich nicht fehl mit der Behauptung, dass die Dozenten mehr von uns gelernt haben als wir von ihnen. Keinesfalls im “rein handwerklichen”: da gab es durchaus Könner wie den Cutter Helmut H. beispielsweise. Hingegen im Argumentationsverständnis und in der Befähigung. Dinge wie Verhältnisse anders als gewohnt sehen zu lernen. Was die Mehrheit der (ständig wechselnden) Dozenten charakterisierte, war ein Mischmasch aus viel Empfinden, etwas Erfahrung und Technik nebst wenig Denken und keine Politik. Bei uns war es umgekehrt, übersteigert. Mit Dozenten (der für mich zuständige Regisseur war Jiri W. aus Prag, 1968 nach Rom emigriert...) war Kommunikation deshalb so erschwert, weil sie uns gar nicht verstehen konnten, kaum eine Ahnung hatten von dem, was wir realisieren wollten. Die “Modernen” um George M. waren nicht weniger “bewusstlos” als die Älteren: mich von einem Gerard V. in Kamera unter weisen zu lassen, lehnte ich kategorisch ab. Herbere Enttäuschungen wurden jene, von denen wir uns etwas erwartet hatten. Doch Ulrich G. erwies sich bald als ein zwischen Direktion und Studentenschaft herumlawierender Feigling, wiewohl er der Direktion biederster Steigbügelhalter war. Das erscheint mir heute eher verständlich: er musste seine Familie ernähren, war freischaffend tätig, der Job (Filmklassiker bestellen und zur Vorführung etwas aus dem eigenen Buch vorlesen, Filmgeschichte genannt) brachte 2 Riesen monatlich. Abstossend war nicht so sehr dieses Verhalten an der DFFB, schliesslich hasste er uns, sondern seine sozial demokratische Filmphilosophie des Masses, des Mittelmasses, der Mittelmässigkeit. Viel bisschen fortschrittlich für den Inhalt, weniger bisschen fortschrittlich für die Form (wobei das natürlich nicht getrennt werden dürfe...), unbeirrt zum Russenfilm hinaufschauend, alles leidenschaftslos zigmal abgewägt und briefmarkengemäss eingeordnet, jeder Übertreibung oder gar Parteilichkeit abhold, bieder bis zum Geruch. Deshalb ist Ulrich G. auch der ideale Juror; wir werden ihn bis zum Jahr 2001 auf allen Festivals und in jedem Auswahlgremium antreffen.
Nichts gegen die Kollegen (für sie auch nichts).
Direktoren waren Dr. Heinz R und Erwin L.; beide wenig von Film und Kino begriffen habend, zeigten sie für das Medium nicht die geringste Sensitivität. Während jedoch Dr. Heinz R ein Verwaltungsprofi ist, geschickt im Geldaufreissen und organisieren, ausserordentlich fleissig, klugerweise sich nie eine Blösse gebend in einer persönlichen Ansicht zu Film und Kino, war Erwin L. schlicht faul und hochstaplerisch. Er schwadronierte mit Sprüchen wie “Film ist Konkretisierung der Zeit”; und hielt wenigstens dasselbe von uns wie wir von ihm. Was unverzeihlich blieb, war neben einem angeblich antifaschistischen Mein Kampf die Provinzialität seines Bluffens (Frühstück mit Ingmar Bergman, Aperitif mit Jean-Luc Godard). Das merkte denn auch bald der Senat, ein Direktor wurde in die Wüste geschickt. Heute muss Dr. Heinz R. konzidiert werden, sein Lebenswerk Filmakademie nicht ungeschickt durch unsere Studentenrevolte gesteuert zu haben – dabei ist er freilich merklich gealtert.
Ich selbst wurde nach 2 Semestern mit anderen Linken wegen “völliger Talentlosigkeit und künstlerischer Unfähigkeit” relegiert; nach einem erheblichen Rabbatz wurden wir als ausserordentliche Studenten wieder aufgenommen, ich gegen Ende des 3. Semesters neuerlich und endgültig wegen Beleidigung der Direktion – ich habe sie nur “Wasserträger des westberliner Senats” geheissen – rausgeschmissen, dann 18 Studenten ein halbes Jahr später. Die Semester an der DFFB erinnern mich an Die Lümmel von der ersten Bank mit mir als Pepe, der Paukerschreck. Jedenfalls war der ganze Zinnober für mich weniger “Bewusstwerdung” denn später Höhepunkt einer zuendegehenden Jugendunbeschwertheit, letztes Sichaustobenkönnen. Ein Stück Kino, das mit Film nichts zu tun hatte.
38.
Von meiner ganzen Mischpocha ist mir Rudolf St. noch der liebste; jedenfalls fühle iich mehr für diesen familiären Underdog als für die Verwandtenbagage mütterlicherseits, hinter deren Fassade steirischer Mittelstandsidylle hysterische Gemeinheit und Ignoranz wuchern; selbst die mir gleichaltrigen Vettern und Basen sind von einer Art Bravheit, die einem die Kehle zuschnüren lässt. In solch “besseren Kreisen” (wobei die jeweilige Zuordnung als Kommunist, Sozialist, Nazi nur des Familienclan Toleranz zu zieren hat) war Onkel Rudi wenig geliebt. Er riss sich, nach dem WWII Gemeindebediensteter, kein Bein sozusagen aus, kam immer “auf die Butterseit’n” (während mein Vater der “Fleissigere und Anständigere” blieb), trieb es unentwegt mit Weibern (klappte es bei einer nicht, versuchte er es bei Schwester oder Freundin), machte beständig Schulden, war mit Intervallen meist täglich etwas besoffen. Er ging eben lieber in die nächste Kneipe als “in die Oper oder ins Konzert”; er konnte sein Lebtag nicht mir und mich unterscheiden und war “kein Geisteskind”, trat dafür in Bars als “Dr. Ott” auf; auch räsonierte er bei einer Operettenaufführung über die Funktion des Dirigenten, “der ja nicht einmal ein Instrument spielt”. Aber Hitler, das wusste mein Onkel, bedeutet Krieg. Während ein paar familiäre Nazi Sachen trieben, die ich allein auf Wunsch meiner Eltern noch nicht zu Papier bringe, war Onkel Rudi an der Ostfront ein als “Drückeberger” tätiger Antifaschist. Schon während der Ausbildung war er auf’s Danebenschiessen aus. In der Sowjetunion versuchte er abenteuerliche Dinge für sein Krankwerden, unter anderem trank er flüssige Margarine in der Hoffnung auf Gelbsucht; nichts schien zu klappen. Zuletzt fabrizierte er sich eine Sandwurst, die er versteckt bei sich trug, mit der er sich beständig aufs Knie klopfte. Dann ging er mit Verformungen und Verletzungen zum Arzt, der ihn bald als Simulant in Verdacht hatte, zuletzt als Selbstverstümmler. Wenn er morgen mit so einem Knie wiederkäme, schrie der Nazimediziner, werde er ihn erschiessen lassen. Aber in so primitive Fallen tappte der Onkel nicht, er ging auch am nächsten Tag zum Sani – und wurde krankgeschrieben.
Als Kind hörte ich seinen Kriegserzählungen gebannt zu; ins Schwärmen kam Onkel Rudi, wenn er von den “herrlichen russischen Mädchen” in Odessa und Charkov erzählte; er war es aber auch der mir als erster mitteilte, was die “unsrigen” in diesem Lande verbrochen haben, er deshalb “den Russen” verstehe.
Wir sahen uns nur noch selten. Als ich an der DFFB studierte, fragte er mich einmal, ob ich dort einen Dr.film machen könne – ich verneinte; ob ich mit Schauspielerinnen wie Romy Schneider, Senta Berger, Elke Sommer zu tun hätte – ich verneinte; enttäuscht kam er nie wieder auf mein “Studium” zurück.
Onkel Rudi hatte zweifelsohne geniale Momente: beispielsweise seine Bereitschaft, beim Kreuzworträtselauflösen ohne mit der Wimper zu zucken ins schwarze Feld weiterzuschreiben.
1966 kam ich mit Jean-Marie St. nach Graz, wo Nicht versöhnt oder Es hilft nur Gewalt, wo Gewalt herrscht aufgeführt wurde, und ich eine Art Einführung sprach. Während die dortigen “Intellektuellen” wichtigmacherisch ihren Joyce zum Verständnis des Films hervorholten, erzählte mir Onkel Rudi ein paar Tage später die “Geschichte von den Generationen einer Architektenfamilie” in einem Begriffenhaben, wie ich es auch später nie wieder erlebt habe.
Onkel Rudi starb am 28. Juni 1973 in Graz im Alter von 64 Jahren an Leberkrebs, 25/1 kg schwer.
39.
Mir fehlten spätnachts im oberhausener Hauptbahnhof vielleicht 70 Pfennige für eine Fahrkarte nach Darmstadt, wo ich erwartet wurde. Ansprechen von ein paar Leuten, denen ich täglich im Festivalsaal begegnet war, versichernd, den Betrag umgehend in Briefmarken zu retournieren; sie sagten nein. Dann einer, sehr schlank, der mir eine Mark gab und mich zum Café einladen wollte. Wir tauschten unsere Adressen und ich rannte auf den Bahnsteig. Wenig später besuchte mich der junge Mann in Westberlin, wir sahen uns wieder bei der Aufnahmeprüfung für die DFFB (für den Fragebogen wollte er von mir wissen, wie man Feuilleton schreibt) und schliesslich fanden wir uns beide aufgenommen im Herbst ‘66 an der Filmakademie. So begann meine Freundschaft mit Holger M.
Durch die sich ständig verschärfenden Auseinandersetzungen mit Kuratorium und Direktion der DFFB sowie nach dem Schock der Ermordung von Benno Ohnesorg gehörte auch Holger M. zu denjenigen, die sich katapulthaft politisierten. In unzähligen Kneipennächten bis zum Hellwerden paukte ich Holger M. sozusagen die Grundthesen des Marxismus ein. In den folgenden Jahren waren wir eng zusammen: er machte – zweifelsohne unser bester Kameramann an der DFFB – die Fotografie für meinen Ein Western für den SDS; wir arbeiteten eine Reihe von Projekten aus; wir prügelten uns mit Bullen (auch auf lustigen Fahrten nach Pesaro und Venedig); wir fuhren nach Frankfurt am Main, weil es dort St-H.s Chronik der Anna Magdalena Bach zu sehen gab (dabei erlebte ich Holger M. das erste- und einzigemal von einem Film erregt und aufgewühlt. Er verteidigte auch ganz entschieden die berühmten Rollenschlusseinstellungen mit Meer und Mond). Holger M. hatte ganz besondere Prinzipien einer Genosseseinvorstellung, die sich beispielsweise in seiner extremen Bereitschaft äusserten, grosszügig alles zu verleihen sowie alles entleihen zu wollen. Er war von einer ungewöhnlichen Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft. Als Autodidakt und SHfbKStudent mit Abitur war er von einer ausgeprägten Antiintellektuellenhaltung. Einmal kam er angeekelt von einem 1. Mai-Vorbereitungskomitee zurück, in dem die Studenten nur diskutiert hätten, der eine Proletarier jedoch konkrete Hinweise machen konnte (wie man einen Wasserwerfer ausser Gefecht setzt). Von da an wurde es Holger M.’ besondere Rolle, Diskussionen nach einiger Zeit mit einem antitheoretischen “Scheisse” zu unterbrechen, indem er das Problem auf die einfachsten Machbarkeitskriterien und Organisationsmöglichkeiten reduzierte. Das wurde ausserst wichtig, wiewohl die Wurzeln aktionistischer Unruhe unverkennbar wurden. Alles in allem dürften wir ein gutes Gespann gewesen sein, weil wir uns ergänzen konnten.
Während des frankfurter Schülerfilmprojektes kam es zwischen uns zu ersten Differenzen. Sie bezogen sich auf den Stellenwert von Film als Instrument gesellschaftsverändernder Praxis. Beide hielten wir nicht viel davon: während Holger M. jedoch die Konsequenzen darin sah, Job und Beruf aufzugeben und in einem anderen Bereich tätig zu sein, bestand ich auf Organisierung und Effektivermachen unseres Bereichs. Ich argumentierte, es sei eine zu private Lösung, Berufe zu wechseln und sich an die Basis heranzuarbeiten: grundsätzlich könne Gruppierungen Berufswechsel nicht zugemutet werden, stattdessen müsste man hilfsweise das eigene Metier politisieren, so unergiebig es auch erscheinen mag. Ein anderer Streitpunkt war unsere Haltung zum Anarchismus. Ich selbst bin keineswegs Gegner anarchistischer Akte an sich, sondern möchte diese nur konkret auf eine historisch zwingende Situation bezogen wissen. Aus politischen und strategisch-machtgelagerten Gründen schloss ich sie für Westeuropa derzeit aus, nicht aus moralischen. Holger M. kam zum gegenteiligen Entschluss. Die aufkommende Fraktionierung verlangte unsere Trennung; im Gegensatz zu vielen anderen Beispielen (und nicht den angenehmsten) hat das unsere Freundschaft nicht berühren können. Wir sahen uns zuletzt in der Mainzerstrasse als er dort aus- und ich da einzog; ein paar Wochen später stürmten gegen 10 Bullen die Wohnung. Als ich am 1. Juni ‘72 von seiner und anderer Verhaftung hörte, war ich betroffen und traurig, obschon ich darauf vorbereitet war; es sind Gefühle, die es an dieser Stelle nicht zu erklären gibt – vielleicht mit Ausnahme eines Solidarischsein weit über Fraktionen und taktische Kalküle hinausgehend.

40.
Seit den Jahren der Kulturrevolution stehe ich auf Seite der VR China – leidlich informiert über Pekings Politik, obschon die Quellenlage vergleichsweise schwierig ist, ich kein Sinologe bin und mir auch die Zeit fehlt, konsequent in die Sachlage einzudringen. Einige aussenpolitische Taktiken sind mir ganz unverständlich, ebenso die unmarxistische Räuberpistole um Lin Piao; den Machtfaktor der Armee würde ich genauer bestimmen können wollen; das Verhalten gegenüber der Sowjetunion (teilparallelisiert zur KP gegenüber den Sozialfaschisten hierzulande vor ’33) kann ich mir nicht “rein politisch” erklärbar machen als Aussenstehender. Dazu vier Anmerkungen:
1) Es mehren sich Reaktionäre, die ganz erleichtert aufatmen, wenn man für die VR China votiert, also gegen die Sowjetunion. Fussballspieler Breitner ist auch keine Empfehlung, die ganze Chinamode nicht. Das ist zugegeben peinlich; und man muss sich schon fragen, warum das so gekommen ist.
2) Die Entwicklung des Sozialismus in der VR China ist so eigen auf besondere und historisch bestimmte Gesellschaftsentwicklungen in diesem Lande verpflichtet, dass man nur mit äusserster Sorgfalt Vorbildsbilder für unsere Entwicklung abziehen darf (deshalb von Fehlern der sowjetischen Entwicklung leichter zu lernen ist als von chinesischen Fortschritten). Diejenigen, die das am wenigsten begriffen haben, waren leider die Fraktionen der ML. Denn gerade im Übertragenwollen von Chiffren, die für ein bestimmtes Land in einer bestimmten Phase des Sozialismus bestimmte Inhalte ausweisen, müsste der Marxist-Leninist das konstatieren, was heutzutage so leichtfertig “revisionistisch” genannt wird.
3) Die Schriften des Vorsitzenden Mao Tse-tung sind deshalb so schwer zu verstehen, weil sie so leicht zu lesen sind (vor Jahren machte ich mir die Mühe, alle deutschsprachigen Ausgaben des Roten Buches miteinander zu vergleichen). Mao wird erst begreiflich in der Würdigung, dem Marxismus-Laninismus keinen neuen Gedanken zugeführt zu haben. Seine Genialität bestand vielmehr darin, die Ideen und Methoden des Marxismus-Leninismus auf die konkrete chinesische Situation angewendet zu haben. Die hierzulande so genossenen Schriften wie Über die Praxis und Über den Widerspruch scheinen m. E. auch die schwächsten von Mao Tse-tung zu sein, seine “philosophischsten” nämlich, während die vielen kleineren Schriften, die wir kaum verstehen können, seine eigentliche Agitationskraft bestimmen. Diese Umkehrung wird durch den Fehler erklärt, das abstrakt-uns Verständliche herauszulesen, was wiederum gerade für China nicht das Bestimmende durch Mao Tse-tung war/ist.
4) Geschichte hört nicht mit dem Sozialismus auf, dieser selbst hat seine Geschichte, die er nur wenig materialistisch zu verstehen bereit ist. Für mich stellt die VR China heute und auf absehbare Zeit den fortgeschrittensten Teil der sozialistischen Bewegung dar (demnach nicht den einzigen). Deshalb stehe ich auf dieser Seite – nicht weil die VR China unfehlbar ist oder ich an Mao wie an den lieben Gott glaube. Dies sei jenen “Maoisten” gesagt, für die es nur Jungfräulichkeit gibt, ein weltgeschichtliches Reinheitsideal als Rauschmittel. Entstehen die ersten Probleme und Störungen, wenden sie sich enttäuscht ab. Dies scheint mir ein grundsätzlich nicht-marxistisches Verhalten zu sein.
41.
Die seltsam leidenschaftliche Liaison mit einer Grazerin, in die ich schon jahrelang zuvor heimlich verliebt war. Was uns gegenseitig nahebrachte, war jenes merkwürdige Verlangen, im Partner zu entdecken und zu mögen, was man selbst nicht besass, mehr noch, was man gar nicht sein wollte, dem bisheriges Dasein so entgegengerichtet war. Für die Trivialisten unter uns: ich schätzte das “bürgerliche” an ihr, sie an mir das “unbürgerliche”. Und wir liebten uns ziemlich.
Sie hatte alles mit den besten Zeugnissen gemacht, war wissenschaftliche Assistentin an der Uni, sehr intelligent, konnte reden + zuhören, und war eine jener Frauen, wiewohl empfindsam, die es nicht nothaben, ständig von Emanzipation zu kwatschen; über eine echte Liberale scheint sie nie hinausgekommen zu sein: alles war geregelt, sie kam stets mit ihrem Geld aus, hatte einen Bausparvertrag; bei dem üblichen Tratsch und einer peinlichen Berührtheit ihrer Familie, mit mir, dem berufslosen Habenichts “zu gehen”, benahm sie sich tapfer. Vieles von dem, was diese empfindende Frau auszeichnete, war mir fremd oder ich war grundsätzlich dagegen eingestellt: bei anderen hätte es mich bis zur Kommunikationslosigkeit gestört. Für sie mag es umgekehrt ähnlich gewesen sein. Aus einer miesen und unbefriedigenden grazer Intellektuellenehe herauskommend, mochte sie in mir den sich gewissen Zwängen nicht unterwerfenden Einzelkämpfer, was sie meine “Freiheiten” nannte, und bestanden diese nur im lange schlafen können, Schuldenmachen oder im frech Autodidaktischen; sie schätzte den dialektisch geschulten Gesprächspartner auf der Suche nach einem starken Partner und insbesondere musste ihr mein bewusster Egoismus ein provisorischer Selbstschutz gegenüber gesellschaftlichem Zwang und mittelständischer Erziehung sein. Die Klammer für uns beide war freilich das Bett. So bedurfte es nach eineinhalb Jahren dann nur eines kleinen Wortwechsels, der uns unsere ganze Verschiedenheit bis zum Entgegengesetztsein klarwerden liess. Wir kamen uns wie nach dem Ritt über den Bodensee vor und trennten uns in der kunstvollen Regle gebliebener Zuneigung. Sie hat in der BRD zum zweitenmal geheiratet, ist Mutter eines 5jährigen Sohnes.
42.
Anfang ‘68 fuhren Holger M. und ich im Auftrage des Studentenrates nach München, kontaktierten Cinéasten für einen allfälligen Prozess gegen den von uns an der DFFB fabrizierten Lehrfilm Herstellung eines Molotow-Cocktails als “Sachverständige” (analog zu Germanistikprofessoren im Kaufhausbrandstifterverfahren gegen Teufel & Co.). Verlegen versuchten die sich der Affäre zu entziehen, einzig Alf B. bewies solidarische Organisationstüchtigkeit. Dr. Alexander K. lud im Namen der Ulmer Hochschule zum Essen ein, besah sich den Kurzfilm, ging mit uns ums Karree spazieren; Ecke Leopold-Ainmillerstrasse verabschiedete er sich mit der Bemerkung, er könne uns leider kein Gutachten schreiben, denn der Molotow-Cocktail sei, im Gegensatz zu uns zweien, nicht dialektisch (genug...). Als ich Jean-Marie St. davon erzählte, knurrte der, Dialektik bestünde für den K. darin, vor dem Schmeissen noch einen kräftigen Schluck aus der Flasche zu nehmen.
43.
Kein Gespür für das, was der Kapitalismus alles verändert hat.... wird es endlich spannend wie im Krimi, wartet man gebannt auf konkrete Sachbezüge, werden “Widersprüche des Kapitalismus” metaphysisch zum Täter. Dass es sie gibt, weiss ja nun wirklich jeder Popel hierzulande: wie sie konkret aussehen, sich verändern/tarnen und wie sie zu Gunsten der Nichtprivilegierten genutzt werden können – das sollte das Who Done It ausmachen.
Es wird mir peinlich, mich schon wieder als konservativen Menschen entlarven zu müssen, aber seit geraumer Zeit lese ich täglich ein paar Seiten MEW. Damit will ich die Schreibe der Neuen Linken (in allen ihren Fraktionen) keineswegs beleidigen, ganz gehöre ich dazu und zu ihnen, doch das, was meine Liebe, Begeisterung wie höllisches Interesse nebst Spannung bei Marx & Engels (und ich betone ausdrücklich auch bei Engels, des öfteren in Unkenntnis geringgeschätzt oder denunziert) ausmacht, ist das Methodische! Bislang finde ich dieses Vermögen nur bei Marx & Engels so genialisch ausgeprägt (in Briefen und wenig bekannten Artikeln im übrigen anschaulicher und nachvollziehbarer). Und wenn sich Marx & Engels auch hundertmal irren, was nachzuweisen keine Schwierigkeit bedeutet, sie irren sich in einer Beweisführung menschlicher Erkenntnis- und Veränderungsfähigkeit, die wie keine andere bislang Fehler zu reduzieren vermochte. Es ist die marxistische Methode – nicht das Zusammenschmeissen genehmer Fakten zu einem Ideologiebild nebst ausgewählten Zitaten. Jeden Tag ein paar Seiten (bevorzugt “unbekannten”) Marx & Engels (in der doch vorzüglichen MEW) lesen und man begreift mehr und endlich, worum es geht, als im soundsovielten Taschenbuch über Germanistik und Revolution, Oper und Klassenkampf etc.
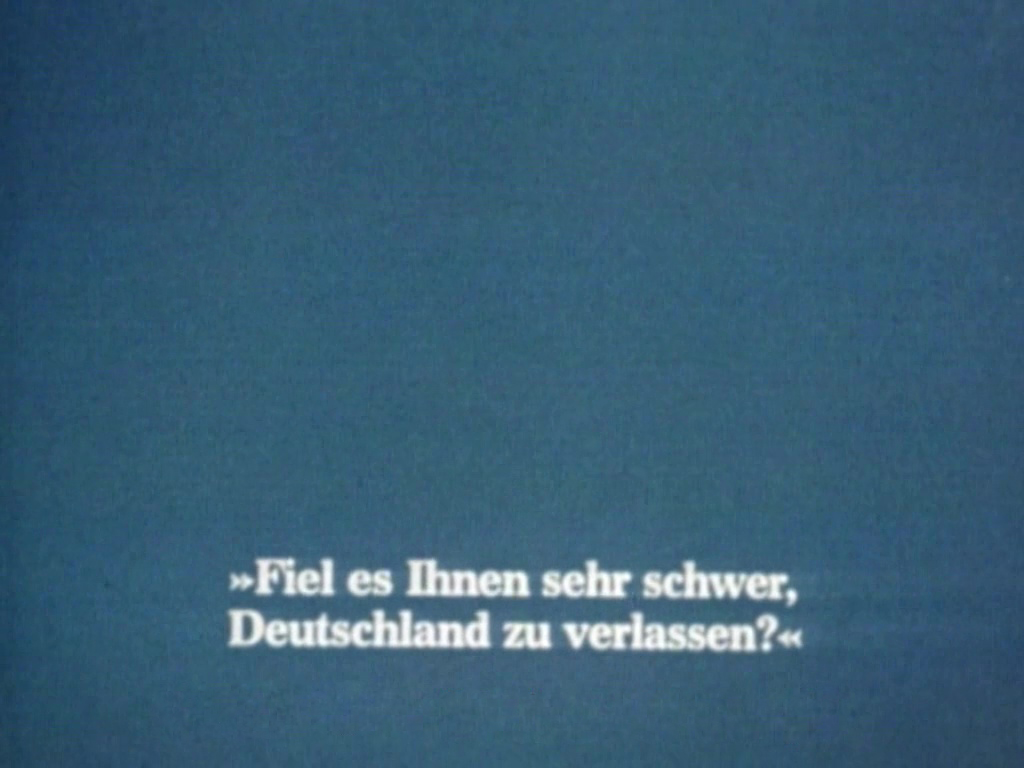
- 1Julian Volz, “Prolegomena. Straschek 1963 – 74 Westberlin (Filmkritik 212, August 1974)”, Sabzian (2022).
Dieser Text wurde ursprünglich als "Straschek 1963-74 Westberlin" in Filmkritik Bd. 8, Nr. 212 (August 1974) erschienen und wird in den kommenden Monaten in 4 Teilen auf Sabzian publiziert werden.
Die belgische CINEMATEK und das Goethe-Institut Brüssel werden Günter Peter Straschek im Juni 2022 eine Retrospektive sowie eine Ausstellung widmen.
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung des Goethe-Instituts Brüssel realisiert.
Mit Dank an Karin Rausch, Julian Volz und Julia Friedrich und das Museum Ludwig Köln für die Bereitstellung der englischen Übersetzung.
Bild (1) Günter Peter Straschek (Mitte), Carlos Bustamante (links) und Johannes Beringer (rechts) am Set von Labriola (1970). Foto: Michael Biron.
Bild (2): Günter Peter Straschek im Es stirbt allerdings ein jeder, fragt sich nur wie und wie Du gelebt hast (Holger Meins) (Renate Sami, 1975)
Bild (3): Filmemigration aus Nazideutschland (Günter Peter Straschek, 1975)
Bild (4): Lotte H. Eisner im Filmemigration aus Nazideutschland (Günter Peter Straschek, 1975)
Bild (5): Filmemigration aus Nazideutschland (Günter Peter Straschek, 1975)

